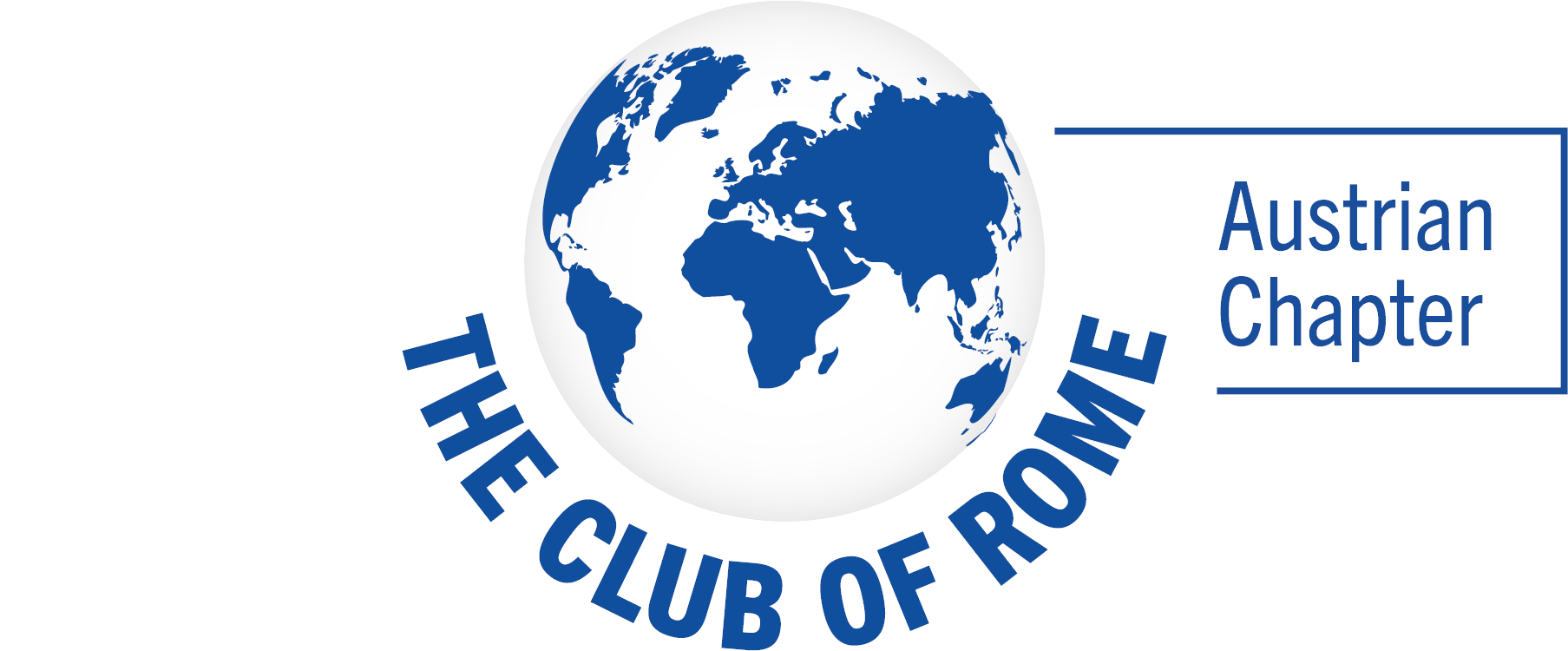von Hannes Swoboda |
Steigende Armutsquote
Neben den verschiedenen Aufgaben im Zusammenhang mit dem Coronavirus gilt es zwei besondere Herausforderungen in den nächsten Jahren zu bewältigen: den Klimawandel und die wieder angestiegene Ungleichheit. In den letzten Jahrzehnten hat es weltweit eine Verringerung der Ungleichheit und damit der Armut gegeben. Obwohl das Virus im Prinzip alle gleichermaßen bedroht, hat es mittelbar zu einem globalen Anwachsen der Armut geführt. Die verschiedenen Lockdowns haben auf die verschiedenen Einkommensgruppen unterschiedliche Auswirkungen. Die Ärmeren, vor allem diejenigen, die mehr oder weniger auf informelle Arbeit und Märkte angewiesen sind, sind ungleich stärker betroffen. Geht die Weltbank „nur“ von einer Unterbrechung des positiven Trends nach unten aus, so rechnet die UNO mit einer starken Steigerung der Armutsquote.
Überdies würde ein längerer Lockdown in einigen Ländern mehr zusätzliche Tote bedeuten, als das Coronavirus selbst mit sich bringen würde. Auch würde das Schließen von Schulen über längere Zeit (z.B. vier Monate) das Lebenseinkommen der Betroffenen um bis zu 15% reduzieren. Das gilt vor allem für jene SchülerInnen, die Schwierigkeiten haben, am digitalen Lernen teilzunehmen. Mitte April waren in den ärmeren Ländern 86% der Jugendlichen zwischen 5 und 17 Jahren ohne Schulzugang. In den reicheren Ländern waren es nur 20%. Es wird also zusätzlicher globaler Anstrengungen bedürfen, um das Anwachsen der Ungleichheit und vor allem der Armutsrate zu bremsen und wieder einen Umkehrtrend in Gang zu setzen. Allerdings im Vergleich zu den allgemeinen Maßnahmen der Konjunkturbelebung betragen die verteilungspolitischen Maßnahmen nur einen geringen Prozentsatz. So beträgt die Errichtung eines digitalen Zugangs für alle SchülerInnen nur 1% der Ausgaben für die allgemeine Wirtschaftsbelebung.
Ökologische Ungleichheit
Auch eine effiziente Klimapolitik darf die Herausforderungen der Ungleichheit nicht vergessen und leugnen. Das gilt sowohl innerstaatlich, für die Gruppe der reichen Länder an sich, als auch global gesehen. Die Reichen belasten im Durchschnitt durch ihren Konsum und ihre Lebensführung die Umwelt stärker und sind im Allgemeinen durch die Umweltschäden weniger betroffen. Besonders krass ist das, wenn wir die Dinge global und im zeitlichen Ablauf betrachten. Die pro Kopf Emissionen von CO2 der USA sind etwa so hoch wie die von 580 Menschen aus Burundi, von 51 Menschen aus Mozambique und 35 Bangladeshis. Für Europa sind die vergleichbaren Werte etwa halb so groß, also noch immer deutlich mehr als in ärmeren Ländern. Obwohl China inzwischen der größte Emittent an CO2 geworden ist, ist hier der pro Kopf Ausstoß nur halb so groß wie in den USA.
Gravierender werden die Unterschiede in zeitlicher Betrachtung. Seriöse Berechnungen ergeben, dass die entwickelten Industrieländer wie die USA, Europa, Japan, Australien für 77 Prozent der Emissionen über den Zeitraum von 1751 bis 2006 verantwortlich waren. Ein Bericht der US National Academy of Science zeigt, dass zwischen 1961 und 2000 die Emissionen der armen Länder Schäden von 740 Milliarden Dollar in den reichen Ländern verursachet haben. Aber umgekehrt haben die reichen Länder Schäden von 2,3 Billionen (= 2.300 Milliarden) Dollar in den armen Ländern bewirkt. Der Reichtum in Europa, den USA etc. und der dadurch verursachte Klimawandel hat damit deutlich zur Ungleichheit beigetragen. Leider haben auch die immer wieder versprochenen „Kompensationsmaßnahmen“ der Wohlhabenden bisher nicht das zugesagte Ausmaß erreicht. Und besonders von den USA sind diesbezüglich keine neuen Initiativen zu erwarten – vor allem solange Donald Trump Präsident ist. Er hat eher die Absicht internationale Verpflichtungen abzubauen.
Damit kommen auf die Klimapolitik in Europa besondere Aufgaben zu. Jeglicher Green Deal muss die globale Entwicklung im Auge haben und neben Maßnahmen im unmittelbaren eigenen Interesse auch ein Wiedergutmachungselement enthalten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Schädigung der Umwelt und die Ausbeutung der Ressourcen in den ärmeren Ländern durch den Konsum der Reichen ja weitergeht. Das betrifft auch manche „Ökologisierung“ in den wohlhabenden Regionen, wie den Umstieg auf die Elektromobilität. Die für die Batterien notwendigen seltenen Metalle werden meist weder menschen- noch umweltfreundlich gewonnen. Und noch immer wird Schrott und anderer Abfall in ärmere Regionen insbesondere nach Afrika exportiert.
Es genügt also nicht, unser Leben in Europa etc. umweltfreundlicher und klimagerechter zu gestalten. Wir müssen da schon global denken und handeln. Das bedeutet keine Geringschätzung von nationalen oder europäischen Aktionsplänen und Maßnahmen. Aber sie sollten immer die globale Dimension berücksichtigen und vor allem die Lebensbedingungen in den ärmeren Ländern verbessern helfen. Dabei sollten wir uns überlegen was eine Übernahme des „westlichen“ Konsumverhaltens durch die armen Länder für unsere Umwelt und die Entwicklung des Klimas bedeuten würde: eine Katastrophe.
Klar ist, dass es bewusster und überlegter politischer Entscheidungen bedarf, um dem Klimawandel entgegen zu treten. Nichts ergibt sich von selbst. Das sieht man am Beispiel des stark gesunkenen Ölpreises. Einige arme Länder können davon profitieren. Andere – auch arme Länder, wie Nigeria – leiden darunter, wenn plötzlich wesentliche Einnahmen wegfallen. Insgesamt bewirkt also der niedrige Ölpreis keine Verringerung der Ungleichheit. Ökologisch könnte er sogar von Nachteil sein, so wie auch der niedrige Preis für Kohle. Daraus könnten Anreize für die Fortsetzung des klimaschädlichen Handelns resultieren. Einerseits könnte der niedrige Benzinpreis dazu führen wieder stärker das Auto zu benützen. Die Verbreitung des Virus könnte da als zusätzliches Argument ins Treffen geführt werden, die öffentlichen Verkehrsmittel zu vermeiden. Und der niedrige Kohlepreis verleitet zum Bau weiterer Kohlekraftwerke, was leider auch in Regionen geschieht, die durch ausreichend Sonnenergie gesegnet sind.
Die Chance nützen
Es bedarf also der klaren politischen Entscheidung einen anderen niedrigen Preis als Investitionsanreiz zu verwenden: die niedrigen Zinsen für Kredite. Wie man gerade angesichts der gegenwärtigen hohen Kreditaufnahmen durch viele Staaten sieht, ist genug Geld vorhanden und auch zu vernünftigen Konditionen verfügbar. Man sollte diese günstigen Konditionen benützen, um vernünftige und das heißt nachhaltige Investitionen zu tätigen. Wenn Staaten und PolitikerInnen, die bislang die „schwarze Null“ für ihre Budgets anstrebten, sich für die Überwindung der aktuellen Krise hoch verschulden, so sollte das für die Bekämpfung des Klimawandels erst recht möglich sein. Da kann ich nur den jüngsten Leitartikel des Economist mit dem Titel „Seize the moment” unterstützen, der sinngemäß meinte, dass das Coronavirus durch die Emissionsunterbrechung nicht als solches klimafreundlich ist, aber die Staaten die Chance des Virus nützen sollten.
Es wird nicht leicht sein, die Menschen zu überzeugen, dass auch für die weniger akuten Herausforderungen Maßnahmen gesetzt werden müssen. Manches mag dabei als Opfer erscheinen, manches auch wirklich ein Opfer abverlangen. Jedenfalls müssen viele Gewohnheiten über Bord geworfen werden. Das macht man nicht gerne, außer man ist von der Notwendigkeit überzeugt und/oder man erwartet sich ein besseres Leben. Die Ergebnisse der Klimapolitik sollten daher grundsätzlich als – notwendige – Verbesserungen empfunden werden können. Ob es um Investitionen in das öffentliche Verkehrssystem, um die Erhaltung der Wälder, der Artenvielfalt und vor allem der eigenen Gesundheit oder auch um die Lebensbedingungen in der europäischen und außereuropäischen Nachbarschaft geht. Politik sollte die Vorteile darstellen und nicht nationale gegen europäische und europäische gegen globale Interessen ausspielen.
Allerdings kann man auch aus der Geschichte lernen. So hat Jared Diamond in seinem monomentalen Werk „Collapse“ nachgewiesen, dass in vielen Fällen Umweltkatastrophen und politischer Niedergang miteinander verbunden waren. Übervölkerung – im Verhältnis zu den Ressourcen – und Klimaveränderungen führen zu Auswanderungsdruck und Kämpfen um Land und andere Ressourcen. Das wird dann oft von Terroristen ausgenützt und führt oft zu Konflikten bis in weit entlegene Regionen. Wie oben erwähnt, sollte die Klimapolitik auch unmittelbar zu einem besseren Leben führen. Sie kann aber auch Unterstützung durch die Abwehr von gegenwärtigen und zukünftigen Gefahren bekommen.
Das Virus hat die gegenseitige globale Abhängigkeit aufgezeigt. Nicht alles muss so bleiben. Aber es ist eine Illusion zu glauben, wir könnten Klimapolitik nur national betreiben. Sie muss europäisch und global eingebettet werden. Das gibt ihr auch mehr Überzeugungskraft. Die Schriftstellerin Margaret Atwood hat diesbezüglich auch gemeint: „So if we fail, we all fail together and we fail big, on a scale unimaginable in the past.“ Einzelne wohlüberlegte Maßnahmen der „Deglobalisierung“ dürfen jedenfalls nicht zu einer Schwächung der globalen Zusammenarbeit führen – im Gegenteil. Dennoch muss jedes Land selbstverständlich seinen eigenen Beitrag leisten. Und ein wenig soziales Gewissen, darf man ja angesichts der immensen globalen Ungleichheit auch zeigen. Das ist sogar im eigenen Interesse. Die Verringerung der Ungleichheit bewirkt einen Beitrag zu einer friedlicheren Welt mit weniger erzwungener Mobilität.